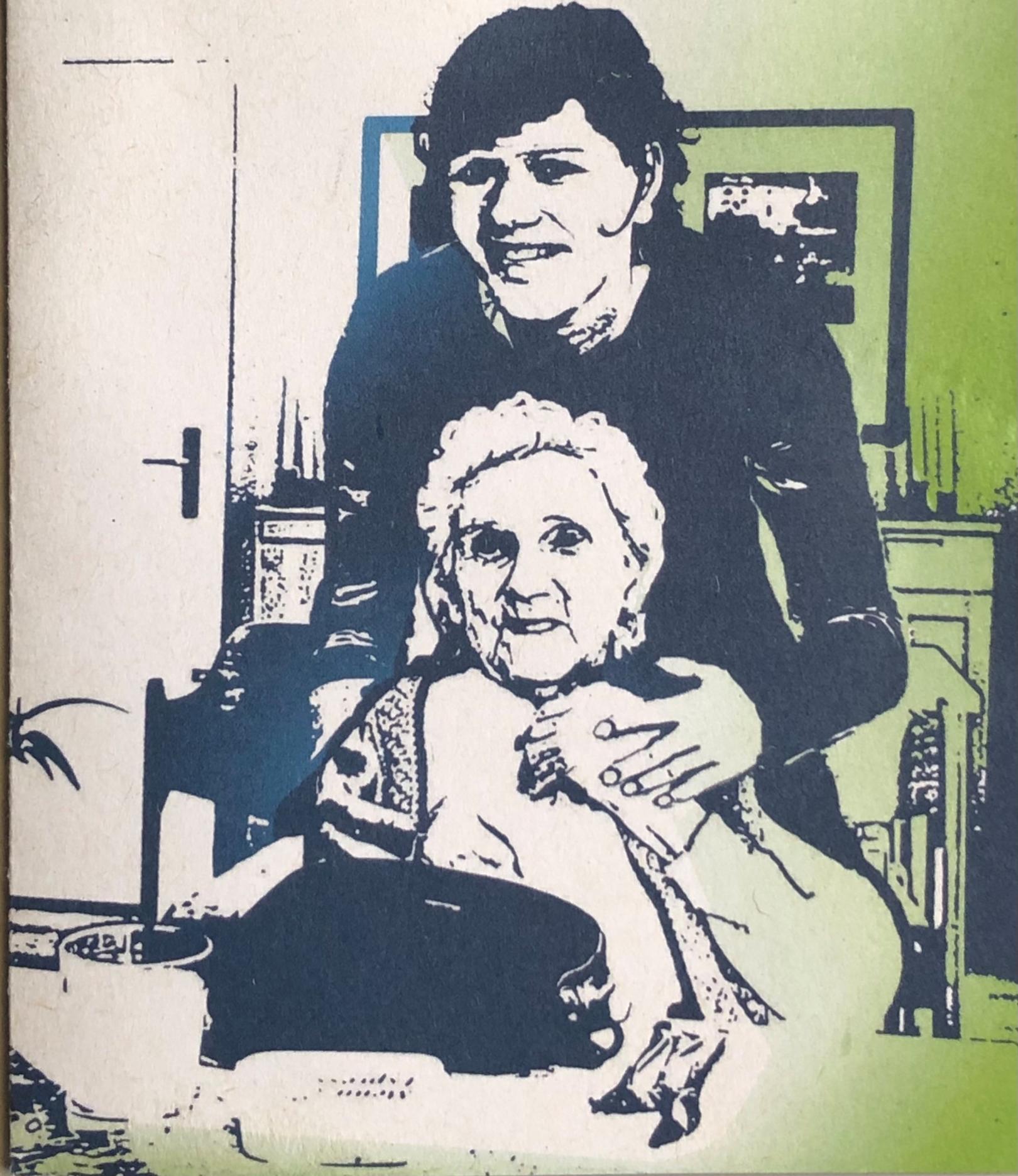Mit der Machete durch den Gesetzesdschungel – aber wie?
Online-Diskussion zur Situation in der häuslichen Pflege – Pflegebedürftige und pflegende Angehörige benötigen Begleitung – Gesellschaft muss sich stärker auf demografischen Wandel einstellen
Unsere Gesellschaft altert. Immer mehr Menschen leben lange. Der Anteil demenziell Veränderter an der Bevölkerung wächst. Auf diese Metatrends ist Deutschland noch nicht eingestellt, trotz etlicher gesetzgeberischen Aktivitäten. Ein Kernproblem für die Umsetzung guter politischer Ziele: die Komplexität der Materie, die Fülle der Situationen, die Unübersichtlichkeit von Vorgaben.
Besonders betroffen: die Menschen, die Angehörige pflegen. Sie müssen sich durch einen wahren Dschungel an Gesetzen, Verordnungen, Antragsformularen schlagen, um Unterstützung zu erhalten. Ob es finanzielle Kompensationen für Auslagen oder ausfallende Arbeitszeiten sind, Hilfsmittel oder Pflegedienstleistungen organisiert und finanziert werden müssen: Überall variieren Fristen, Bedingungen, Berechtigungen, Nachweispflichten und vieles mehr. Unüberschaubar und unbeherrschbar. Zu der persönlichen Belastung im Alltag kommt so die bürokratische Überforderung.
Das Problem ist bekannt, aber nicht gebannt – und die Aussichten auf Besserung eher getrübt. Diese ehrliche Einschätzung teilten alle Fachleute bei einer Online-Diskussion der Bischöflichen Kommission „Kirche und Arbeiterschaft“ am 3. Dezember 2020: der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Christof Stock von der Katholischen Hochschule NRW Abt. Aachen ebenso wie die fachpolitisch engagierten Bundestagsabgeordneten Dr. Rudolf Henke und Claudia Moll. Stock wollte einen Überblick geben, aber räumte ein, dass das selbst für einen gestandenen Juristen nicht einfach sei. Moll sagte, sie habe lange an einer verständlichen Einführung ins Thema gearbeitet. Und Henke zeigte zur Illustration eine Einführung ins Pflegerecht des Bundesgesundheitsministeriums: 250 Seiten stark.
Rudolf Henke war es auch, der das Dilemma der Politik aufwies: die Fülle der Situationen, in denen Pflegebedürftige und pflegende Angehörige stecken, ist einfach zu vielfältig, um die entlastenden Instrumente zu vereinfachen. Ein zu grober Zuschnitt von Voraussetzungen, Fristen, Förderungen würde viele Menschen unverhältnismäßig benachteiligen oder bevorteilen. Er meldete Zweifel an, ob die mancherorts diskutierten persönlichen Budgets für Pflege dieses Dilemma wirklich auflösen oder eher neue bürokratische Hürden aufbauen würden. Claudia Moll war da etwas zuversichtlicher, aber teilte ansonsten die Analyse. Niemand, wirklich niemand, kommt mit der Komplexität der Materie ohne intensive Auseinandersetzung zurecht, Fachbeamte nicht, Fachpolitiker nicht und erst recht nicht betroffene Pflegebedürftige und pflegende Angehörige. Es braucht daher Unterstützung.
Diese steht in Form der Pflegeberatung bereit. Die gesetzgeberischen Grundlagen dafür sind bereitet, wie ohnehin die Pflegegesetzgebung besser ist als ihr Ruf, wie es einmütig in der Fachveranstaltung hieß. Das Problem liegt eher vor Ort in der Umsetzung, es liegt im Engagement der beteiligten Akteure wie der zuständigen kommunalen Gebietskörperschaft, der Kranken- und Pflegekassen. Wenn es gut läuft wie in der StädteRegion Aachen, sind Pflegestützpunkte am Start und es arbeiten dort engagierte Fachfrauen mit Herzblut für die Menschen, wie zum Beispiel Andrea Amen vom AOK-Pflegestützpunkt Aachen. Sie bewegt sich punktgenau und sicher durch die gigantische Matrix der Gesetze, Verordnungen und Antragsformulare. Menschen wie sie haben am ehesten die Machete in der Hand, mit der sie Hilfesuchenden eine passgenaue Schneise durch den Dschungel schlagen.
Die Hilfe geht über eine reine Erstinformation und über die Hilfestellung beim Erstantrag hinaus. Zuviel kann schief gehen, kann sich ändern, kann komplizierter werden im Verlauf des Pflegealltags. Es braucht eine regelrechte Begleitung, eigentlich eine Art Coaching, das auch psychosoziale Hilfe bei der existentiell herausfordernden Situation beinhaltet. Bis das in der Fläche etabliert ist und auch mit der nötigen Tiefe, dauert es. In diese Landschaft von Lotsen muss investiert werden, will man halbwegs humane Bedingungen in der häuslichen Pflege herstellen. Das gilt natürlich auch für die teils ungesichert beschäftigten Pflegekräfte aus Osteuropa, welche die Mängel der Situation für die betroffenen Familien kompensieren, aber zu Lasten ihrer eigenen Lebenslage. Auch hier gilt es dranzubleiben, um Unrecht abzubauen und reguläre Verhältnisse zu etablieren.
Eines ist klar: Ihre demografische Entwicklung wird die Gesellschaft immer stärker herausfordern und sie braucht einen neuen Umgang damit. Ein pflegender Angehöriger machte das bei der Online-Diskussion am eigenen Erleben deutlich, am Beispiel der demenziell veränderten Menschen. So viele Pflegeeinrichtungen und Pflegekräfte könne man gar nicht aufbauen und ausbilden, wie künftig benötigt werde, um dieser Bevölkerungsgruppe ein würdiges Leben zu ermöglichen. Es sei ja ohnehin das Beste für die Betroffenen, in ihrem gewohnten Umfeld weiterleben zu können. Damit das gelinge, im Sinne der demenziell Veränderten und ihrer Angehörigen, sei ein allgemeiner Mentalitätswandel nötig. Die Gesellschaft müsse Demenz und den richtigen Umgang damit verstehen lernen, damit die Betroffenen sich so selbstständig wie möglich im Quartier bewegen können.
All diese Punkte nehmen die Mitglieder der Bischöflichen Kommission „Kirche und Arbeiterschaft“ mit in die weitere Beratung, wie sich Kirche und Gesellschaft auf die Herausforderungen in der Sorgearbeit einstellen sollen. Als Kooperationspartner bei der Online-Diskussion waren mit an Bord: die katholische Betriebsseelsorge im Bistum Aachen, der Deutsche Gewerkschaftsbund Region NRW Süd-West, der kfd-Diözesanverband Aachen und das Nell-Breuning-Haus. Bei einer Fachtagung am 26. Februar 2021 sollen die Themen, die auf den Tisch gelegt wurden, vertieft werden. Jede Initiative sei wichtig, um das gemeinsame Anliegen in die Fläche zu tragen, betonte Moderator Dr. Manfred Körber vom Nell-Breuning-Haus. Dafür wurden am 3. Dezember 2020 gute Grundlagen gelegt.